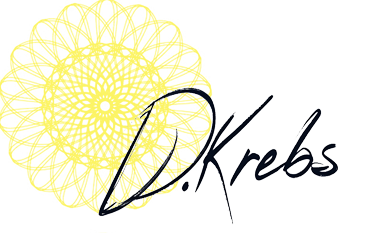Die Vererbung von Immobilien und Wohnrechten ist ein vielschichtiges Thema, das neben rechtlichen Fragen auch finanzielle und steuerliche Implikationen mit sich bringt. Insbesondere, wenn es um das lebenslange Wohnrecht geht, spielen familiäre Bindungen und die langfristige Nutzung einer Wohnung oder eines Eigenheims eine zentrale Rolle.
In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die verschiedenen Aspekte der Vererbung eines Wohnrechts und beantworten dabei Fragen zu Rechten und Pflichten, Nießbrauchrecht und Erbschaftssteuer.
Haus vererben: Das sollten Sie beachten
Die Entscheidung, ein Haus zu vererben, sollte gut durchdacht werden. Insbesondere bei der Vererbung von Eigenheimen an die eigenen Kinder oder andere Verwandte stellt sich die Frage, ob und wie ein Wohnungsrecht eingeräumt werden soll.
Ein Haus stellt oft einen großen Teil des Vermögens dar, und das Erben ist mit steuerlichen Pflichten verbunden. Es ist ratsam, frühzeitig zu klären, ob es sinnvoll ist, ein lebenslanges Wohnrecht für eine Person einzutragen, etwa für einen Elternteil oder andere Familienmitglieder.
Alles wichtige zum Thema Immobilien vererben finden Sie in diesem Artikel.

Kann ein Wohnrecht vererbt werden?
Ein eingetragenes Wohnrecht, wie ein Wohnrecht auf Lebenszeit, erlischt normalerweise mit dem Tod des Berechtigten. Das bedeutet, es kann nicht direkt vererbt werden. Dennoch gibt es Möglichkeiten, das Wohnungsrecht an Kinder oder andere Begünstigte weiterzugeben, indem ein Nießbrauchrecht eingeräumt wird.
Im Gegensatz zum Wohnrecht ermöglicht der Nießbrauch die Nutzung der Immobilie auch über die bloße Bewohnung hinaus, etwa durch Vermietung.
Wer kann ein Wohnrecht vererben?
Jeder Eigentümer einer Wohnung oder eines Hauses kann ein Wohnrecht einräumen, indem er dies im Grundbuch vermerkt. Dies gilt für Eltern, die ihren Kindern das Recht einräumen möchten, nach ihrem Tod weiterhin in der Immobilie zu wohnen.
Es ist auch möglich, Dritten wie Lebenspartnern ein solches Recht zu gewähren. Wichtig ist hierbei, dass das Wohnungsrecht in der Regel nicht vererbt werden kann, es sei denn, der Nießbrauch wurde vertraglich festgelegt.
Wann sollte ein Wohnrecht vererbt werden?
Das Vererben eines Wohnrechts sollte dann in Betracht gezogen werden, wenn der Eigentümer sicherstellen möchte, dass eine bestimmte Person, wie etwa ein Kind oder ein Elternteil, auch nach dem eigenen Tod in der Wohnung oder dem Haus wohnen kann.
Ein frühzeitiges Einräumen des Wohnrechts, eventuell durch Schenkung, kann zudem helfen, Erbschaftsstreitigkeiten innerhalb der Familie zu vermeiden.
Nießbrauch vererben
Im Unterschied zum Wohnrecht bietet das Nießbrauchrecht umfassendere Nutzungsmöglichkeiten. Ein Nießbrauchrecht gibt dem Berechtigten nicht nur das Recht, die Wohnung zu bewohnen, sondern auch wirtschaftlich zu nutzen, zum Beispiel durch Vermietung.
Das Nießbrauchrecht wird häufig für Eltern eingeräumt, die weiterhin in ihrem Eigenheim wohnen, es aber bereits an die Kinder überschrieben haben. Der Nießbrauch erlischt ebenfalls in der Regel mit dem Tod des Berechtigten, kann jedoch vertraglich anders gestaltet werden.
Lebenslanges Wohnrecht
Das lebenslange Wohnrecht ist eine spezielle Form des Wohnrechts, das oft in Kombination mit einer Schenkung des Hauses oder der Wohnung an die Kinder vereinbart wird. Eltern behalten sich hierbei das Recht vor, bis zu ihrem Lebensende in der Immobilie zu wohnen.
Dies ist insbesondere für Eltern von Vorteil, die ihren Kindern das Eigenheim frühzeitig übertragen möchten, aber weiterhin die Wohnung nutzen wollen. Solche Vereinbarungen sollten unbedingt im Grundbuch eingetragen werden, um rechtlich abgesichert zu sein.

Rechte und Pflichten für den Erben des Wohnrechts
Für den Erben einer Immobilie, an die ein Wohnrecht oder Nießbrauchrecht gekoppelt ist, ergeben sich spezielle Rechte und Pflichten. Der Erbe ist weiterhin der Eigentümer der Wohnung oder des Hauses, darf aber nicht frei darüber verfügen, solange das Wohnrecht besteht.
Gleichzeitig ist der Erbe verpflichtet, für die Instandhaltung der Immobilie zu sorgen und anfallende Kosten wie Grundsteuern oder Versicherungen zu tragen. Auch wenn das Wohnrecht vererbt wird, darf es vom Erben nicht einseitig aufgelöst werden, sofern keine vertraglichen Vereinbarungen zum Widerruf bestehen.
Wertminderung durch Nießbrauch
Der Wert des Wohnrechts bzw. des Nießbrauchrechts kann den Gesamtwert einer Immobilie erheblich mindern. Dies liegt daran, dass das Nutzungsrecht des Berechtigten den neuen Eigentümer einschränkt, insbesondere wenn das lebenslange Wohnrecht eingetragen ist.
In der Praxis wird der Marktwert der Immobilie durch den Wert des Wohnrechts reduziert, was sich bei einem möglichen Verkauf oder bei der Berechnung der Erbschaftssteuer niederschlägt.
Vererbung vom Grundbucheintrag
Damit ein Wohnrecht oder Nießbrauchrecht auch nach dem Tod des ursprünglichen Eigentümers rechtsgültig bleibt, muss es im Grundbuch eingetragen werden. Das Wohnrecht erlischt normalerweise mit dem Tod des Berechtigten, sodass ein erneuter Eintrag für nachfolgende Nutzer erforderlich ist.
Dies gilt auch für den Fall, dass der Berechtigte ein Nießbrauchrecht übertragen möchte. Es empfiehlt sich, frühzeitig juristische Beratung in Anspruch zu nehmen, um Fehler beim Grundbucheintrag zu vermeiden.
Wohnrecht: Diese Widerrufsmöglichkeiten haben Sie
Ein Wohnrecht oder Nießbrauchrecht kann in der Regel nicht ohne weiteres widerrufen werden, es sei denn, es wurden entsprechende vertragliche Klauseln vereinbart. Widerrufsmöglichkeiten können beispielsweise an bestimmte Bedingungen geknüpft sein, wie einen Umzug oder das Ableben des Berechtigten.
Ist ein lebenslanges Wohnrecht eingetragen, kann es nur schwer rückgängig gemacht werden. Daher sollten solche Rechte gut überlegt und klar formuliert werden.
Verkauf des Wohnrechts
Das Wohnrecht ist in der Regel nicht übertragbar und somit auch nicht verkäuflich. Der Nießbrauch hingegen bietet in seltenen Fällen die Möglichkeit, das Recht zu übertragen oder zu verkaufen, sofern dies vertraglich festgelegt wurde.
Auch der Verkauf der Immobilie ist bei einem eingetragenen Wohnrecht oder Nießbrauchrecht möglich. Der neue Eigentümer übernimmt dabei das Wohnungsrecht, was jedoch oft den Kaufpreis mindert.
Erbschaftssteuern bei der Vererbung von Immobilien
Beim Vererben von Immobilien fallen Erbschaftssteuern an, deren Höhe von mehreren Faktoren abhängt, darunter der Grad der Verwandtschaft und der Wert des Wohnrechts. Das lebenslange Wohnrecht kann den Wert der Immobilie mindern, was zu einer Reduzierung der Erbschaftssteuer führt.
Kinder haben in der Regel höhere Freibeträge bei der Erbschaft, was eine Schenkung zu Lebzeiten steuerlich vorteilhaft macht.
Die Steuerklassen der Erbschaftssteuer
Steuerklasse I: Ehepartner, ingetragene Lebenspartner, Kinder, Stiefkinder, Enkel, Urenkel
Steuerklasse II: Geschwister, Nichten, Neffen, Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern, geschiedene Ehepartner und getrennte Lebenspartner
Steuerklasse III: alle sonstigen Erben
Die Höhe der verschiedenen Steuerklassen
Grundsätzlich ist die Erbschaftssteuer der verschiedenen Steuerklassen von dem Wert des gesamten Nachlasses abhängig. Bei einer großen Erbschaft müssen also mehr Steuern gezahlt werden:
| Höhe der Erbschaftssteuer | Steuerklasse I | Steuerklasse II | Steuerklasse III |
| bis zu 75.000 € | 7% | 15% | 30% |
| bis zu 300.000 € | 11% | 20% | 30% |
| bis zu 600.000 € | 15% | 25% | 30% |
| bis zu 6.000.000 € | 19% | 30% | 30% |
| bis zu 13.000.000 € | 23% | 35% | 50% |
| bis zu 26.000.000 € | 27% | 40% | 50% |
| mehr als 26.000.000 € | 30% | 43% | 50% |
Schenkung zur Vermeidung der Erbschaftsteuer
Viele Eltern entscheiden sich dafür, ihre Wohnung oder ihr Haus zu Lebzeiten an ihre Kinder zu verschenken, um hohe Erbschaftssteuern zu vermeiden. Diese Schenkungen können mit einem Wohnrecht oder Nießbrauch kombiniert werden, sodass die Eltern weiterhin in der Immobilie wohnen dürfen.
Dies ist besonders vorteilhaft, da der Wert des Wohnrechts oder Nießbrauchrechts den steuerpflichtigen Wert der Immobilie mindern kann. Dennoch sollte man auch bei einer Schenkung eventuelle Steuern zu beachten. Dabei gelten die gleichen Steuerklassen und Steuerquoten wie bei einer ordinären Erbschaft.
Schenkung von Immobilien: den Pflichtteilsergänzungsanspruch beachten
Bei der Schenkung einer Immobilie ist der Pflichtteilsergänzungsanspruch ein wichtiger Aspekt. Kinder oder andere Pflichtteilsberechtigte können unter bestimmten Umständen einen Teil des Wertes der Wohnung einfordern, wenn die Immobilie zu Lebzeiten verschenkt wurde. Dieser Anspruch reduziert sich über die Jahre und erlischt nach zehn Jahren vollständig.
Einen ausführlichen Artikel zum Thema Pflichtteilsergäntungsanspruch finden Sie hier.
Wohnrecht vererben: Top-Beratung mit den Experten von VH24
Das lebenslange Wohnrecht und die Vererbung von Immobilien erfordern eine sorgfältige Planung. Ob es sich um das Einräumen eines Nießbrauchrechts, das Eintragen eines Wohnungsrechts oder die steuerliche Optimierung durch Schenkungen handelt – rechtliche Beratung ist unerlässlich, um spätere Konflikte zu vermeiden und das Vermögen optimal zu übertragen.
Besonders Eltern, die ihr Eigenheim an die Kinder weitergeben möchten, sollten frühzeitig Maßnahmen ergreifen, um sowohl steuerliche Vorteile zu nutzen als auch klare rechtliche Regelungen für die Zukunft zu schaffen.
Unsere Partnerkanzleien sind auf das Erbrecht spezialisiert und haben bereits unzählige Klienten bei Ihrer Erbschaft begleitet. Profitieren auch Sie von unserer Expertise und vereinbaren Sie noch heute einen kostenlosen Beratungstermin.