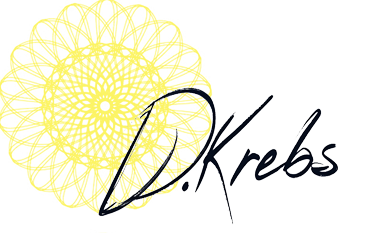Der Pflichtteilsergänzungsanspruch ist ein komplexes Thema, das tief in das Erbrecht eingreift und sicherstellt, dass nahe Angehörige nicht durch großzügige Schenkungen des Erblassers benachteiligt werden.
In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit den verschiedenen Aspekten dieses Rechts befassen. Von den Grundlagen des Pflichtteils über die Definition und Bewertung von Schenkungen bis hin zu den speziellen Regelungen, wie der 10-Jahres-Regel, beleuchten wir alle relevanten Punkte, die für das Verständnis des Pflichtteilsergänzungsanspruchs wichtig sind.
Was ist ein Pflichtteil?
Der Pflichtteil ist ein gesetzlich festgelegter Mindestanteil am Erbe, der bestimmten nahen Angehörigen des Erblassers zusteht, selbst wenn sie im Testament nicht bedacht wurden. Das Pflichtteilsrecht soll sicherstellen, dass bestimmte Erben, wie Kinder oder Ehepartner, nicht vollständig enterbt werden können. In der Regel haben diese dem Erblasser nahestehende Personen immer Pflichtteilsansprüche.
Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils und ist in der Regel in Geld auszuzahlen. Dabei geht es nicht darum, dass der Pflichtteilsberechtigte zwangsläufig einen direkten Erbanspruch hat, sondern dass er zumindest einen finanziellen Ausgleich für seinen entgangenen Erbteil erhält.
Welche Personen haben einen Anspruch auf den Pflichtteil?
Anspruch auf den Pflichtteil haben in erster Linie die direkten Abkömmlinge des Erblassers, also Kinder und Enkelkinder, sowie der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner. Wenn keine Nachkommen vorhanden sind, können auch die Eltern des Erblassers pflichtteilsberechtigt sein.
Geschwister oder weiter entfernte Verwandte haben jedoch keinen Anspruch auf den Pflichtteil. Der Pflichtteil steht den Berechtigten auch dann zu, wenn sie im Testament nicht bedacht wurden oder wenn sie vom Erblasser bewusst enterbt wurden. Die gesetzliche Erbfolge wird hierdurch jedoch nicht verändert, sondern lediglich ergänzt. Alles zum Thema Pflichtteil können Sie hier nachlesen.
Was ist eine Schenkung?
Eine Schenkung im rechtlichen Sinne ist eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen unentgeltlich bereichert. Im Kontext des Erbrechts spielt die Schenkung eine besondere Rolle, da sie unter Umständen Pflichtteilsergänzungsansprüche auslöst.
Eine Schenkung kann in verschiedenen Formen erfolgen, sei es durch Übertragung von Geld, Immobilien oder anderen Vermögenswerten. Wichtig ist, dass die Schenkung zu Lebzeiten des Erblassers erfolgt und unentgeltlich ist, also ohne eine entsprechende Gegenleistung.
Wenn Sie mehr über Schenkungen erfahren wollen, können Sie das in diesem Artikel tun.

Was gilt als Schenkung?
Nicht jede Zuwendung des Erblassers an Dritte wird als Schenkung im erbrechtlichen Sinne betrachtet. Damit eine Zuwendung als Schenkung gilt, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehört, dass der Erblasser eine freiwillige und unentgeltliche Zuwendung vorgenommen hat, die den Beschenkten bereichert und sein eigenes Vermögen entsprechend mindert.
Als Schenkungen gelten neben klassischen Geld- oder Sachgeschenken auch Verzichtserklärungen, z.B. auf eine Rückzahlung von Schulden, oder die Übertragung von Nutzungsrechten, wie Nießbrauchsrechten.
Einfach erklärt: Was ist der Pflichtteilsergänzungsanspruch?
Der Pflichtteilsergänzungsanspruch ist ein gesetzlicher Anspruch (§2325 Pflichtteilsergänzungsanspruch), der dazu dient, bestimmte nahe Angehörige des Verstorbenen finanziell abzusichern, wenn sie im Testament übergangen oder enterbt wurden.
Wenn ein Erblasser zu Lebzeiten große Geschenke oder Vermögensübertragungen gemacht hat, kann dies den Nachlass stark verringern und somit den Pflichtteil der berechtigten Angehörigen schmälern. Der Pflichtteilsergänzungsanspruch sorgt dafür, dass diese Geschenke bei der Berechnung des Pflichtteils berücksichtigt werden.
Konkret bedeutet das: Wenn ein naher Angehöriger durch Geschenke des Erblassers benachteiligt wird, hat er das Recht, seinen Pflichtteil aus den Schenkungen nachträglich zu fordern. Dies stellt sicher, dass selbst bei umfangreichen Schenkungen zu Lebzeiten der Erblasser trotzdem einen angemessenen Anteil seines Erbes erhält.
Gemischte Geschenke
Ein Sonderfall im Bereich der Schenkungen sind sogenannte gemischte Schenkungen. Dabei handelt es sich um Zuwendungen, bei denen eine Gegenleistung erbracht wird, die jedoch unter dem tatsächlichen Wert der erhaltenen Zuwendung liegt.
Ein typisches Beispiel wäre der Verkauf einer Immobilie zu einem deutlich unter dem Marktwert liegenden Preis an einen nahen Angehörigen. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Marktwert und dem Kaufpreis gilt als Schenkung und kann beim Pflichtteilsergänzungsanspruch relevant werden.
Geschenke unter Eheleuten
Schenkungen zwischen Ehegatten haben im Erbrecht eine besondere Bedeutung, insbesondere wenn die Ehegatten einen Güterstandsvertrag abgeschlossen haben.
Je nach vereinbartem Güterstand (z.B. Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung oder Gütergemeinschaft) können sich die rechtlichen Auswirkungen von Schenkungen zwischen Ehepartnern erheblich unterscheiden.
Bei einer Zugewinngemeinschaft kann etwa die Übertragung von Vermögenswerten auf den Ehepartner als Schenkung gewertet werden, die im Rahmen des Pflichtteilsergänzungsanspruchs berücksichtigt werden muss.

Lebensversicherungen
Lebensversicherungen spielen häufig eine Rolle bei der Regelung des Nachlasses. Wenn der Erblasser eine Lebensversicherung zugunsten einer bestimmten Person abgeschlossen hat, stellt sich die Frage, ob diese Leistung als Schenkung zu betrachten ist.
Grundsätzlich wird die Auszahlung einer Lebensversicherung nicht automatisch als Schenkung gewertet. Allerdings kann der Rückkaufswert der Lebensversicherung, sofern sie vor dem Tod des Erblassers auf den Begünstigten übertragen wurde, als Schenkung angesehen werden und somit den Pflichtteilsergänzungsanspruch beeinflussen.
Stiftungen
Eine besondere Herausforderung stellen Zuwendungen des Erblassers an Stiftungen dar. Wenn der Erblasser Vermögen auf eine Stiftung überträgt, um beispielsweise einen bestimmten Zweck zu fördern, kann dies ebenfalls eine Schenkung darstellen.
Besonders kompliziert wird es, wenn die Stiftung kurz vor dem Tod des Erblassers gegründet wurde, um das Vermögen dem Zugriff der Pflichtteilsberechtigten zu entziehen. In solchen Fällen ist zu prüfen, ob die Übertragung als Schenkung zu werten ist, die im Rahmen des Pflichtteilsergänzungsanspruchs geltend gemacht werden kann.
Die 10-Jahres-Regel
Eine zentrale Regelung im Pflichtteilsergänzungsanspruch ist die sogenannte 10-Jahres-Regel. Diese besagt, dass Schenkungen, die der Erblasser innerhalb von zehn Jahren vor seinem Tod vorgenommen hat, in den Pflichtteilsergänzungsanspruch einbezogen werden können.
Je länger die Schenkung zurückliegt, desto geringer sind die Beiträge des Pflichtteilsergänzungsanspruchs. Nach Ablauf von zehn Jahren wird die Schenkung vollständig außer Betracht gelassen.
Eine wichtige Ausnahme gilt jedoch für Schenkungen zwischen Ehepartnern: Diese unterliegen der 10-Jahres-Regel nicht, sodass sie auch nach Ablauf dieser Frist noch den Pflichtteilsergänzungsanspruch beeinflussen können.

Übersicht Höhe des Pflichtteilsergänzungsanspruchs
Eine genaue Übersicht über die Höhe des Anteils, der auf den Pflichtteil angerechnet wird, können Sie unserer Tabelle entnehmen:
| Zeitpunkt der Schenkung | Angerechneter Anteil der Schenkung |
| 1 Jahr vor dem Erbfall | 100 % |
| 2 Jahre vor dem Erbfall | 90 % |
| 3 Jahre vor dem Erbfall | 80 % |
| 4 Jahre vor dem Erbfall | 70 % |
| 5 Jahre vor dem Erbfall | 60 % |
| 6 Jahre vor dem Erbfall | 50 % |
| 7 Jahre vor dem Erbfall | 40 % |
| 8 Jahre vor dem Erbfall | 30 % |
| 9 Jahre vor dem Erbfall | 20 % |
| 10 Jahre vor dem Erbfall | 10 % |
| 11 oder mehr Jahre vor dem Erbfall | Keine Anrechnung der Schenkung |
Wenn eine Schenkung also 1 Jahr vor dem Todesfall vollzogen wird, wird die Schenkung zu 100% auf den Nachlass angerechnet und der Pflichtteilsanspruch verringert sich nicht. Erst wenn die Schenkung mehr als 10 Jahre zurückliegt, haben enterbte Verwandte keinen Anspruch auf einen Anteil der Schenkung.
Beispiel Pflichtteilsergänzungsanspruch
Um den Pflichtteilsergänzungsanspruch anschaulicher zu machen, betrachten wir folgendes Beispiel: Angenommen, Herr Müller hat zwei Kinder, Max und Lisa, und hinterlässt ein Testament, in dem er Max als Alleinerben einsetzt und Lisa komplett enterbt. Zu Lebzeiten hat Herr Müller zudem eine großzügige Schenkung in Höhe von 200.000 Euro an einen guten Freund, Herrn Schmidt, gemacht und ein Haus im Wert von 300.000 Euro verkauft, wobei der Verkaufspreis nur 100.000 Euro betrug. Beide Transaktionen liegen innerhalb der letzten zehn Jahre vor Herrn Müllers Tod.
Im Rahmen des Pflichtteilsergänzungsanspruchs müssen nun die Schenkungen und der gemischte Verkaufspreis berücksichtigt werden, um zu ermitteln, ob und in welchem Umfang Lisa einen Anspruch auf eine Pflichtteilsergänzung hat. Die 10-Jahres-Regel besagt, dass alle Schenkungen innerhalb dieser Frist in die Berechnung einfließen. Das bedeutet, dass die 200.000 Euro an Herrn Schmidt und die Differenz zwischen dem tatsächlichen Wert des Hauses (300.000 Euro) und dem erzielten Verkaufspreis (100.000 Euro) in Höhe von 200.000 Euro summiert werden.
Lisa, die als Pflichtteilsberechtigte Anspruch auf die Hälfte des gesetzlichen Erbteils hat, könnte einen Pflichtteilsergänzungsanspruch geltend machen, der sich nach der Summe dieser Schenkungen und der gemischten Schenkung bemisst. Der Gesamtwert der Schenkungen und der gemischten Geschenke beträgt hier also 400.000 Euro.
Lisa hat Anspruch auf ihren Pflichtteil an diesem gesamten Nachlass, was ihre Erbquote entsprechend erhöht und in diesem Fall zu einer Zahlung von Max an Lisa führen kann, um den Anspruch zu erfüllen. Das Beispiel zeigt deutlich, wie Schenkungen und deren Bewertung Einfluss auf den Betrag des Pflichtteilsergänzungsanspruchs haben und wie komplex die Berechnung in der Praxis sein kann.
Fristen und Verjährung beim Pflichtteilsergänzungsanspruch
Im Zusammenhang mit dem Pflichtteilsergänzungsanspruch spielen Fristen und Verjährungen eine wichtige Rolle. Der Pflichtteilsergänzungsanspruch verjährt in der Regel drei Jahre nach Kenntnis des Anspruchs und der relevanten Umstände.
Diese Frist beginnt jedoch spätestens zehn Jahre nach dem Tod des Erblassers. Wer einen Pflichtteilsergänzungsanspruch geltend machen möchte, sollte daher frühzeitig alle notwendigen Informationen einholen und rechtliche Schritte einleiten, um seine Ansprüche nicht zu verlieren.
Insbesondere wenn Zweifel darüber bestehen, ob und in welchem Umfang Schenkungen erfolgt sind, ist es ratsam, frühzeitig tätig zu werden.
Wie erfahre ich von einer Schenkung?
Die Frage, wie ein Pflichtteilsberechtigter von Schenkungen des Erblassers erfahren kann, ist entscheidend für die Geltendmachung des Pflichtteilsergänzungsanspruchs. In der Praxis ist es oft schwierig, von Schenkungen zu erfahren, die der Erblasser zu Lebzeiten vorgenommen hat, insbesondere wenn diese nicht öffentlich dokumentiert wurden.
Um dennoch Kenntnis von relevanten Schenkungen zu erlangen, stehen dem Pflichtteilsberechtigten verschiedene rechtliche Mittel zur Verfügung, wie etwa die Einsichtnahme in Bankunterlagen oder das Einholen von Informationen bei Dritten, die mit dem Erblasser in Verbindung standen.

Auskunftspflicht bei einer Pflichtteilsergänzungsanspruch
Die Auskunftspflicht ist ein zentrales Instrument, um die notwendigen Informationen für die Geltendmachung des Pflichtteilsergänzungsanspruchs zu erhalten. Der Erbe oder der Beschenkte ist verpflichtet, auf Anfrage des Pflichtteilsberechtigten umfassend Auskunft über den Bestand des Nachlasses und über etwaige Schenkungen zu geben.
Diese Auskunft umfasst nicht nur eine Aufstellung der Vermögenswerte, sondern auch eine detaillierte Angabe über alle Schenkungen, die der Erblasser in den letzten zehn Jahren vor seinem Tod vorgenommen hat. Verweigert der Erbe die Auskunft, kann der Pflichtteilsberechtigte seine Ansprüche gerichtlich durchsetzen.
Zeitpunkt der Bewertung der Schenkung
Ein weiterer wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit dem Pflichtteilsergänzungsanspruch ist der Zeitpunkt, zu dem die Schenkungen bewertet werden. Maßgeblich ist dabei in der Regel der Zeitpunkt des Todes des Erblassers, nicht der Zeitpunkt der Schenkung selbst.
Das bedeutet, dass Schenkungen, die beispielsweise vor mehreren Jahren erfolgt sind, auf den Wert zum Zeitpunkt des Erbfalls aktualisiert werden müssen. Dies kann insbesondere bei Immobilien oder Wertpapieren, deren Wert stark schwankt, zu erheblichen Unterschieden in der Berechnung des Pflichtteilsergänzungsanspruchs führen.
Pflichtteilsergänzungsanspruch und Nießbrauch
Der Nießbrauch ist ein Nutzungsrecht, das häufig in Verbindung mit Schenkungen an Dritte vergeben wird. Wenn der Erblasser einem Dritten Vermögen überträgt und sich selbst ein Nießbrauchsrecht vorbehält, stellt sich die Frage, wie dieser Nießbrauch im Rahmen des Pflichtteilsergänzungsanspruchs zu behandeln ist.
Grundsätzlich mindert der Nießbrauch den Wert der Schenkung, da der Beschenkte das Vermögen nicht vollständig nutzen kann. Entsprechend wird der Wert der Schenkung, der dem Pflichtteilsergänzungsanspruch zugrunde liegt, um den Wert des Nießbrauchs reduziert.
Wer zahlt die Pflichtteilsergänzung?
Die Frage, wer letztlich die Pflichtteilsergänzung zu zahlen hat, ist von großer praktischer Bedeutung. Grundsätzlich ist der Erbe zur Zahlung des Pflichtteilsergänzungsanspruchs verpflichtet. Allerdings kann sich der Anspruch auch gegen den Beschenkten richten, wenn der Nachlass zur Deckung des Pflichtteils nicht ausreicht.
In diesem Fall muss der Beschenkte den Pflichtteilsergänzungsanspruch aus dem erhaltenen Geschenk befriedigen. Dies kann insbesondere bei großen Schenkungen dazu führen, dass der Beschenkte einen erheblichen Teil des erhaltenen Vermögens abgeben muss, um den Pflichtteilsanspruch zu erfüllen.
Rechtliche Herausforderungen und Durchsetzung des Anspruchs
Die Durchsetzung des Pflichtteilsergänzungsanspruchs kann rechtlich komplex und streitbehaftet sein. Häufig treten Unklarheiten darüber auf, welche Schenkungen berücksichtigt werden müssen und wie deren Wert zu bestimmen ist. Hierbei kann die Rechtsprechung eine wichtige Orientierung bieten.
Ein Beispiel für relevante Rechtsprechung ist das Urteil des Bundesgerichtshofs im Fall IV ZR 249/14. Dieses Urteil befasst sich mit Fragen zur Anrechnung von Schenkungen und der Bewertung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem Pflichtteilsergänzungsanspruch.
Solche Entscheidungen des BGH sind von großer Bedeutung, um zu verstehen, wie Gerichte in spezifischen Fällen entscheiden und welche rechtlichen Prinzipien zur Anwendung kommen. Daher ist es für Pflichtteilsberechtigte unerlässlich, sich über aktuelle Rechtsprechung zu informieren, um ihre Ansprüche erfolgreich durchzusetzen.
Pflichtteilsergänzungsanspruch: Top-Beratung mit den Partnerkanzleien von VH24
Der Pflichtteilsergänzungsanspruch stellt sicher, dass nahe Angehörige trotz großzügiger Schenkungen des Erblassers nicht leer ausgehen. Um diesen Anspruch erfolgreich geltend zu machen, müssen Pflichtteilsberechtigte ihre Rechte genau kennen und rechtzeitig die notwendigen Schritte einleiten.
Dies umfasst die sorgfältige Prüfung von Schenkungen, die Einforderung umfassender Auskünfte und gegebenenfalls die Durchsetzung der Ansprüche vor Gericht. In jedem Fall ist es ratsam, sich frühzeitig rechtlich beraten zu lassen, um die eigenen Ansprüche bestmöglich durchzusetzen und die rechtlichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen.
Die Partnerkanzleien von VH24 sind auf das Erbrecht und speziell auf den Pflichtteil spezialisiert. Gemeinsam konnten wir schon unzähligen Klienten zu Ihrem rechtmäßigen Pflichtteil verhelfen. Profitieren auch Sie von unserer Expertise und vereinbaren Sie noch heute einen kostenlosen Beratungstermin.