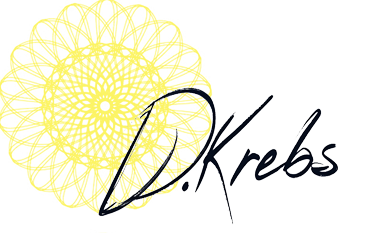Das Erbrecht in Deutschland regelt, wie das Vermögen einer verstorbenen Person – des sogenannten Erblassers – auf die Erben übergeht. Ein zentraler Bestandteil des Erbrechts ist das Ehegattenerbrecht, welches die Rechte und Pflichten des überlebenden Ehepartners im Todesfall regelt.
Die Regelungen des Ehegattenerbrechts sind eng mit den verschiedenen ehelichen Güterständen verknüpft, und die genaue Ausgestaltung der Erbfolge hängt davon ab, ob der Erblasser ein Testament hinterlassen hat oder ob die gesetzliche Erbfolge greift. Dieser umfassende Artikel beleuchtet die verschiedenen Aspekte vom Ehegattenerbrecht, einschließlich der gesetzlichen Erbfolge, der Rolle der Kinder und anderer Angehöriger, sowie der Auswirkungen einer Scheidung oder des Ablebens eines Ex-Ehepartners.
Die verschiedenen Güterstände der Ehe
Die güterrechtliche Regelung, die ein Ehepaar wählt oder die automatisch gilt, wenn keine besondere Vereinbarung getroffen wird, beeinflusst maßgeblich das Ehegattenerbrecht. In Deutschland gibt es drei wesentliche Güterstände:
- Zugewinngemeinschaft: Diese Form des Güterstands ist der gesetzliche Standard, der automatisch gilt, wenn das Ehepaar keine andere Regelung vereinbart hat. In einer Zugewinngemeinschaft bleibt das Vermögen, das jeder Ehepartner in die Ehe einbringt, weiterhin dessen Eigentum. Der Zugewinn – also der Vermögenszuwachs während der Ehe – wird jedoch im Falle einer Scheidung oder im Erbfall ausgeglichen. Der Zugewinnausgleich beeinflusst maßgeblich das Erbrecht der Ehegatten, insbesondere wenn keine gemeinsamen Kinder vorhanden sind.
- Gütertrennung: Bei der Gütertrennung bleibt das Vermögen der Ehepartner vollständig getrennt. Es gibt keinen Zugewinnausgleich im Falle einer Scheidung oder im Todesfall eines Ehepartners. Jeder Partner verwaltet sein Vermögen selbstständig, und im Erbfall gilt die gesetzliche Erbfolge, die sich nicht durch einen Zugewinn erhöht. Diese Regelung wird häufig gewählt, wenn beide Ehepartner über bedeutende Vermögenswerte verfügen und diese strikt voneinander trennen möchten.
- Gütergemeinschaft: Bei der Gütergemeinschaft wird das Vermögen des Ehepaares weitgehend gemeinschaftlich verwaltet. Dieser Güterstand bedeutet, dass sowohl das in die Ehe eingebrachte als auch das während der Ehe erworbene Vermögen gemeinsames Eigentum beider Ehepartner wird. Es gibt jedoch Ausnahmen, etwa für das sogenannte Sondergut. Im Todesfall des Erblassers wird der Nachlass in der Regel zur Hälfte zwischen dem überlebenden Ehegatten und den weiteren gesetzlichen Erben aufgeteilt.
Ehegattenerbrecht und die gesetzliche Erbfolge
Kommt es zum Tod eines Ehepartners und existiert kein Testament oder Erbvertrag, tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft. Diese ist in den §§ 1924 ff. BGB geregelt und bestimmt, in welcher Reihenfolge die Erben berücksichtigt werden. Der Ehegatte des Erblassers nimmt dabei eine herausgehobene Stellung ein. Er gehört zur ersten Erbordnung, sofern gemeinsame Kinder vorhanden sind.
Diese ersten Erben erhalten die Erbschaft in einer bestimmten Reihenfolge, beginnend mit den Abkömmlingen, gefolgt von den Eltern, Geschwistern und deren Nachkommen. Gibt es keine Abkömmlinge, rücken die Eltern und ihre Abkömmlinge, also die Geschwister des Verstorbenen, als Erben nach. Großeltern des Erblassers und deren Nachkommen fallen unter die zweite Erbordnung. Der überlebende Ehepartner ist hierbei immer erbberechtigt, aber sein Erbteil variiert je nach der Ordnung der anderen Erben und dem gewählten Güterstand. Mehr über die gesetzliche Erbfolge können Sie hier erfahren.

Gesetzliche Erbfolge und Zugewinngemeinschaft
Im Falle einer Zugewinngemeinschaft, die in den meisten Ehen besteht, sieht das Ehegattenerbrecht vor, das der Erbteil des überlebenden Ehepartners durch die gesetzliche Erbfolge aufgestockt wird. Zusätzlich zum regulären Erbteil erbt der überlebende Ehegatte ein Viertel des Nachlasses als pauschalen Zugewinnausgleich. Diese Regelung soll sicherstellen, dass der überlebende Partner finanziell abgesichert ist, insbesondere wenn gemeinsame Kinder des Erblassers vorhanden sind, die ebenfalls erben.
Bei einer Scheidung kann der Anspruch auf den Zugewinnausgleich stark variieren, insbesondere wenn der Erblasser und der Ex-Ehepartner in einem andauernden Scheidungsverfahren stehen, bevor das Urteil rechtskräftig wird.
Gesetzliche Erbfolge bei einer Zugewinngemeinschaft in einer kinderlosen Ehe
In kinderlosen Ehen, in denen eine Zugewinngemeinschaft besteht, erhöht sich der Erbteil des überlebenden Ehegatten signifikant, wenn keine Abkömmlinge vorhanden sind. In diesem Fall erbt der Ehegatte die Hälfte des Nachlasses und zusätzlich das pauschale Zugewinnausgleichsviertel, sodass er insgesamt drei Viertel des Nachlasses erhält. Das verbleibende Viertel geht an die nächsten Verwandten des Erblassers, wie Eltern oder Geschwister, oder an die Großeltern, wenn keine näheren Verwandten vorhanden sind.
Gesetzliche Erbfolge und Gütertrennung
In einer Ehe mit Gütertrennung bleibt das Vermögen strikt getrennt, und es erfolgt kein Zugewinnausgleich im Todesfall. Dies hat direkte Auswirkungen auf die gesetzliche Erbfolge. Stirbt ein Ehepartner ohne Testament, erhält der überlebende Partner nur den gesetzlichen Erbteil, der in diesem Fall allein von der Anzahl der erbberechtigten Verwandten des Erblassers abhängt.
Gibt es zum Beispiel keine Kinder, aber noch lebende Eltern oder Geschwister des Verstorbenen, erbt der Partner die Hälfte des Nachlasses, während die andere Hälfte unter den Eltern oder Geschwistern aufgeteilt wird. Gibt es Kinder, so erbt der überlebende Ehepartner lediglich ein Viertel des Nachlasses, während die restlichen drei Viertel unter den Kindern aufgeteilt werden.
Fehlen nahe Verwandte, wie Kinder, Eltern oder Geschwister, erbt der überlebende Partner den gesamten Nachlass. Die Gütertrennung kann daher in bestimmten Fällen zu einem deutlich geringeren Erbteil des Ehepartners führen, da der Vermögenszuwachs während der Ehe nicht berücksichtigt wird und somit der Erbteil ausschließlich nach den erbrechtlichen Vorschriften verteilt wird.
Gesetzliche Erbfolge und Gütergemeinschaft
Anders stellt sich die Situation bei der Gütergemeinschaft dar. In diesem Güterstand gehört das Vermögen gemeinschaftlich beiden, was auch Einfluss auf das Erbrecht des überlebenden Ehegatten hat. Im Todesfall erhält der überlebende Ehegatte in der Regel die Hälfte des gesamten Vermögens, das nicht zum Sondergut zählt.
Die andere Hälfte des gemeinschaftlichen Vermögens fällt dann an die gesetzlichen Erben, zu denen auch der überlebende Partner gehören kann, je nach der Ordnung der Verwandten. Da es in einer Gütergemeinschaft keinen Zugewinnausgleich gibt, entfällt der pauschale Ausgleich, der in der Zugewinngemeinschaft üblich ist.
Wann macht es Sinn bei einer Zugewinngemeinschaft das Erbe auszuschlagen?
In bestimmten Fällen kann es sinnvoll sein, dass der überlebende Ehegatte das Erbe ausschlägt, um stattdessen den güterrechtlichen Zugewinnausgleich zu verlangen. Dies ist insbesondere dann ratsam, wenn der Nachlass des Erblassers stark überschuldet ist oder wenn der Zugewinn, den der überlebende Ehegatte geltend machen kann, beträchtlich höher ist als der gesetzliche Erbteil.
Durch die Ausschlagung des Erbes verzichtet der Ehegatte auf alle Rechte am Nachlass, erhält jedoch seinen Ausgleichsanspruch, der dann vor den Forderungen anderer Erben oder Gläubiger bedient wird. Es ist jedoch zu bedenken, dass eine Erbausschlagung auch den Verzicht auf eventuelle positive Nachlasswerte bedeutet.
Beispiel zur Erbschaftsausschlagung zugunsten des Zugewinnausgleichs im Ehegattenerbrecht
Stellen wir uns vor, ein Ehepaar lebte in einer Zugewinngemeinschaft. Der verstorbene Partner hat ein Vermögen von 100.000 Euro hinterlassen, aber auch Schulden in Höhe von 50.000 Euro. Der überlebende Partner hat während der Ehe einen Zugewinn von 200.000 Euro erwirtschaftet, während der Zugewinn des verstorbenen Ehepartners nur 50.000 Euro beträgt.
In der Zugewinngemeinschaft gilt, dass der Zugewinn des Ehepartners, der weniger erwirtschaftet hat, dem anderen ausgeglichen werden muss. Der überlebende Ehegatte hätte also einen Anspruch auf 75.000 Euro (die Hälfte der Differenz von 150.000 Euro). Wenn der überlebende Partner das Erbe annehmen würde, bekäme er gemäß der gesetzlichen Erbfolge (die Hälfte des Nachlasses plus das pauschale Viertel des Zugewinnausgleichs) 75.000 Euro aus dem Nachlass. Aufgrund der Schulden des Nachlasses würden jedoch nur 25.000 Euro netto übrig bleiben.
Schlägt der Ehepartner hingegen das Erbe aus und fordert stattdessen den Zugewinnausgleich, könnte er die vollen 75.000 Euro verlangen, ohne dabei die Schulden des Nachlasses berücksichtigen zu müssen. Der Zugewinnausgleich wird vor der Verteilung des Nachlasses durchgeführt, wodurch der Ehepartner in diesem Beispiel finanziell deutlich besser dasteht.
Rechtliche Konsequenzen und Vorgehensweise
Die Erbschaftsausschlagung ist eine formelle Handlung, die innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Kenntnis des Erbfalls vor einem Notar oder beim Nachlassgericht erklärt werden muss. Es ist wichtig, dass diese Entscheidung gut überlegt und rechtlich beraten wird, da sie unwiderruflich ist und weitreichende Konsequenzen für den Partner sowie die übrigen Erben haben kann.
Wenn der überlebende Partner die Erbschaft ausschlägt und den Zugewinnausgleich geltend macht, tritt er nicht als Erbe auf, sondern erhält seinen Anspruch aus dem Gesamtguthaben des Nachlasses. Erst nach diesem Ausgleich wird der verbleibende Nachlass unter den gesetzlichen Erben verteilt. Dies kann dazu führen, dass der überlebende Ehegatte mehr Vermögen erhält, insbesondere wenn der Zugewinn im Laufe der Ehe auf seiner Seite deutlich höher war.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ausschlagung der Erbschaft zugunsten des Zugewinnausgleichs besonders dann sinnvoll ist, wenn der Nachlass gering oder überschuldet ist, oder wenn der überlebende Partner durch den Zugewinnausgleich mehr erhalten würde als durch die gesetzliche Erbfolge. Es handelt sich hierbei um eine komplexe Entscheidung, die eine sorgfältige Abwägung und rechtliche Beratung erfordert.
Ehegattenerbrecht: Gemeinschaftliche Testamente für Ehepaare
Ein gemeinschaftliches Testament ist eine besondere Form der letztwilligen Verfügung, die von Ehepaaren oder eingetragenen Lebenspartnern gemeinsam errichtet wird. Es ermöglicht den Ehepartnern, ihre Erbfolge genau zu regeln und die wirtschaftliche Absicherung des überlebenden Partners zu gewährleisten.
Diese Form des Testaments ist besonders geeignet, um Konflikte unter den Erben zu vermeiden und sicherzustellen, dass der Nachlass den gemeinsamen Wünschen der Partner entspricht. Ein gemeinschaftliches Testament kann sowohl privatschriftlich als auch notariell errichtet werden und bietet eine hohe Sicherheit und Verbindlichkeit.

Gleichzeitig gemeinsames Testament
Das gleichzeitig gemeinschaftliche Testament ist die einfachste Form eines gemeinschaftlichen Testaments. Beide Ehepartner setzen in einem Dokument ihre Verfügungen von Todes wegen fest und unterzeichnen dieses Dokument gleichzeitig.
Diese Form des Testaments ermöglicht es den Ehepartnern, ihre Erbfolge klar und eindeutig zu regeln. Ein solches Testament ist zwar rechtlich bindend, kann jedoch von jedem Ehepartner zu Lebzeiten jederzeit widerrufen werden, solange beide Partner noch leben.
Gegenseitiges Testament
Ein gegenseitiges Testament, auch als Erbeinsetzung bezeichnet, legt fest, dass die Ehepartner sich gegenseitig als Erben einsetzen. Stirbt ein Partner, erbt der überlebende Partner das gesamte Vermögen des verstorbenen Erblassers. Erst nach dem Tod des zweiten Ehepartners erben die Kinder oder andere festgelegte Personen.
Diese Regelung ist in vielen Ehen üblich, da sie dem überlebenden Ehepartner die finanzielle Absicherung garantiert und gleichzeitig die Weitergabe des Vermögens an die gemeinsamen Kinder sicherstellt. Ein gegenseitiges Testament bindet die Partner jedoch auch, da es nach dem Tod des ersten Partners nur schwer widerrufen werden kann.
Wechselbezügliches Testament
Ein wechselbezügliches Testament stellt eine besondere Form des gemeinschaftlichen Testaments dar, bei dem die Verfügungen der Partner in einem engen Zusammenhang stehen und voneinander abhängig sind. Hierbei vereinbaren die Ehepartner, dass die Verfügungen des einen Partners nur unter der Bedingung gelten, dass der andere Partner dieselben Regelungen trifft.
Diese Bindung verhindert, dass nach dem Tod des ersten Ehepartners der überlebende Partner das Testament einseitig ändert. Ein bekanntes Beispiel für ein wechselbezügliches Testament ist das Berliner Testament, bei dem sich die Partner gegenseitig als Alleinerben einsetzen und die Kinder als Schlusserben.
Berliner Testament
Das Berliner Testament ist die häufigste Form des wechselbezüglichen Testaments in Deutschland. Hierbei setzen sich die Ehepartner gegenseitig als Alleinerben ein, während die Kinder erst nach dem Tod des zweiten Ehepartners erben.
Diese Regelung sichert den überlebenden Partner finanziell ab und verhindert, dass die Kinder sofort nach dem Tod des ersten Elternteils ihren Erbteil einfordern. Allerdings kann das Berliner Testament auch Nachteile haben, insbesondere im Hinblick auf die Pflichtteilsansprüche der Kinder und die steuerlichen Freibeträge, die unter Umständen nicht optimal ausgenutzt werden.

Auswirkung einer Scheidung auf die Erbschaft
Eine Scheidung hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Ehegattenerbrecht. Sobald die Ehe rechtskräftig geschieden ist, verliert der Ex-Ehepartner jegliche Erb- und Pflichtteilsansprüche. Hat der Erblasser jedoch ein Testament zugunsten des Ex-Ehepartners errichtet und dieses nicht nach der Scheidung geändert, bleibt das Testament gültig.
In einem solchen Fall muss das Testament entsprechend angepasst werden, um unerwünschte Erbfolgen zu vermeiden. Auch während eines anhängigen Scheidungsverfahrens kann es zu komplizierten rechtlichen Situationen kommen, insbesondere wenn der Erblasser während des Verfahrens verstirbt.
Freibeträge im Ehegattenerbrecht
Ehegatten genießen im deutschen Erbrecht besonders hohe Steuerfreibeträge. Der Freibetrag liegt derzeit bei 500.000 Euro. Dieser hohe Freibetrag ermöglicht es, dass der überlebende Partner in vielen Fällen keine Erbschaftsteuer zahlen muss. Auch für Schenkungen unter Lebenden, die häufig als vorgezogene Erbfolge angesehen werden, gilt derselbe Freibetrag. Darüber hinaus kann der überlebende Partner zusätzliche Steuervergünstigungen in Anspruch nehmen, beispielsweise für den sogenannten „Versorgungsfreibetrag“, der zusätzlich bis zu 256.000 Euro betragen kann.
Was passiert mit dem Hausrat?
Der Hausrat gehört im Todesfall nicht automatisch zum allgemeinen Nachlass. Stattdessen steht der Hausrat in den meisten Fällen dem überlebenden Ehepartner zu. Dazu zählen alle Gegenstände, die dem gemeinsamen Haushalt dienen, wie Möbel, Küchengeräte, und persönliche Dinge des täglichen Bedarfs. Der überlebende Ehegatte hat Anspruch auf diese Gegenstände, unabhängig davon, ob sie im Testament erwähnt werden oder nicht. Dies soll sicherstellen, dass der überlebende Partner seinen bisherigen Lebensstandard fortführen kann, ohne auf das Einverständnis der Erben angewiesen zu sein.
Sonderregelung im Ehegattenerbrecht: Recht des Dreißigsten
Das sogenannte „Recht des Dreißigsten“ ist eine besondere Schutzregelung im Ehegattenerbrecht. Es besagt, dass der überlebende Ehepartner nach dem Tod des Erblassers für einen Zeitraum von 30 Tagen das Recht hat, in der gemeinsamen Wohnung zu verbleiben und aus dem Nachlass den bisherigen Lebensunterhalt zu bestreiten. Diese Regelung greift unabhängig davon, wer Erbe wird, und soll sicherstellen, dass der überlebende Partner nicht sofort in finanzielle Not gerät.
Enterbungen von Ehegatten und Pflichtteilsanspruch im Ehegattenerbrecht
Trotz des gesetzlichen Erbteils kann es vorkommen, dass ein Ehepartner vom Erblasser enterbt wird. Dies geschieht in der Regel durch ein Testament oder einen Erbvertrag, in dem der Ehegatte explizit vom Erbe ausgeschlossen wird. In solchen Fällen bleibt dem enterbten Partner jedoch der Pflichtteilsanspruch.
Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils und muss in Geld ausgezahlt werden. Auch wenn der Erblasser den Ehepartner enterbt, kann der Pflichtteil nicht vollständig ausgeschlossen werden, es sei denn, es liegen schwerwiegende Gründe vor, wie etwa eine erhebliche Verfehlung des enterbten Ehepartners.
Beispiel zur Berechnung des Pflichtteils bei Enterbung eines Ehepartners
Um die Höhe des Pflichtteils bei der Enterbung eines Ehepartners zu verdeutlichen, betrachten wir folgendes Beispiel: Angenommen, ein verheirateter Erblasser hinterlässt ein Vermögen von 600.000 Euro. Der Erblasser hat zwei Kinder, die ebenfalls erbberechtigt sind, und es besteht eine Zugewinngemeinschaft. Ohne Testament würde der Ehepartner nach der gesetzlichen Erbfolge die Hälfte des Nachlasses erben, also 300.000 Euro. Die beiden Kinder würden sich die andere Hälfte teilen und jeweils 150.000 Euro erhalten.
Wenn der Erblasser jedoch den Ehepartner in einem Testament enterbt und seine beiden Kinder als alleinige Erben einsetzt, bleibt dem Partner dennoch der Pflichtteilsanspruch. Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Da der gesetzliche Erbteil des Ehepartners 300.000 Euro betragen hätte, steht ihm nun ein Pflichtteil von 150.000 Euro zu. Dieser Betrag muss in Geld ausgezahlt werden und mindert entsprechend den Anteil der Erben, in diesem Fall der Kinder, die nun statt 300.000 Euro nur noch 450.000 Euro unter sich aufteilen müssen.
Top-Beratung zum Ehegattenerbrecht mit den Partnerkanzleien von VH24
Das deutsche Ehegattenerbrecht bietet zahlreiche Schutzmechanismen, um den überlebenden Ehepartner abzusichern, von der Zugewinngemeinschaft bis hin zu speziellen Freibeträgen und dem Recht des Dreißigsten. Gleichzeitig bestehen aber auch Möglichkeiten für den Erblasser, die Erbfolge nach seinen Wünschen zu gestalten – durch Testamente oder Erbverträge.
In jedem Fall ist es ratsam, sich rechtzeitig über die verschiedenen Optionen zu informieren und gegebenenfalls rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass das Erbe im Sinne aller Beteiligten geregelt wird. Die Partnerkanzleien von VH24 sind auf das Erbrecht spezialisiert und können Sie in allen erbrechtlichen Belangen kompetent beraten. Profitieren auch Sie von unserer langjährigen Expertise und vereinbaren Sie noch heute einen kostenlosen Beratungstermin.